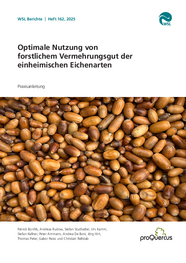Genetische Vielfalt und Naturschutzgenetik ¶
Die Genetische Vielfalt ist für das langfristige Überleben jeder Art von zentraler Bedeutung. Wir erforschen ökologische Prozesse in Populationen von Pilzen, Pflanzen und Tieren mit genetischen Methoden und ergänzen diese mit experimentellen Untersuchungen.
Inhalt ¶
Welche Organismen kommen in einem Lebensraum vor? Wie beeinflussen Strassen die Ausbreitung und Vernetzung von Populationen? Wie wirkt sich Inzucht auf seltene Arten aus? Antworten auf diese Fragen können mithilfe genetischer Methoden gefunden werden.
Wir verwenden unter anderem Umwelt- oder eDNA, um Lebensräume zu überwachen oder seltene Arten nachzuweisen. Denn Erbgut von Tieren, Pilzen oder Pflanzen ist überall, in der Luft, im Wasser, im Boden. Das eDNA-Labor der WSL ist speziell für solche Untersuchungen ausgerüstet. Um Proben von eDNA auch in «unzugänglichen» Lebensräumen sammeln zu können, verwenden wir modernste Geräte wie etwa speziell entwickelte Drohnen.
Bei unseren Untersuchungen konzentrieren wir uns auf Arten, die im Ökosystem eine wichtige Rolle spielen oder die in der Schweiz und weltweit selten oder gefährdet sind. Unsere Erkenntnisse bilden wichtige Grundlagen für die Planung und Umsetzung von Naturschutzmassnahmen, aber auch für den Waldbau.
Verwandte Themen ¶
Kontakt ¶
Forschungseinheiten:
Forschungsgruppen:
WSL-Publikationen ¶