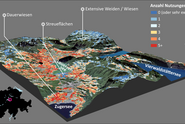Zu den am stärksten gefährdeten und in Deutschland kurz vor dem Aussterben stehenden Pflan-zengesellschaften zählt der Flechten-Kiefernwald (Cladino-Pinetum sylvestris, Syn. Cladonio-Pinetum sylvestris). Aus diesem Grund wurde er von der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft als „Pflanzengesellschaft des Jahres 2025“ ausgewählt. Flechten-Kiefernwälder sind wenig produktive, lichte und unterwuchsarme Nadelwald-Ökosysteme vorwiegend der planaren und kollinen Stufe. Prägende Standortfaktoren sind extrem nährstoffarme und saure, meist auch sehr trockene Böden mit gering entwickelter Humusauflage. Flechten-Kiefernwälder kommen auf Sandern, Moränen, Dünen und Talsanden und im Bergland punktuell auf Felsen aus Granit, Quarzit oder Sandstein vor. In Deutschland sind Bestände dieses Waldtyps aktuell nur noch kleinflächig und überwiegend in subkontinental geprägten Regionen vorhanden. Die Hauptvorkommen liegen im nordostdeutschen Binnenland von der niedersächsischen Elbtalniederung an ostwärts (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg) sowie in Mittelfranken und der Oberpfalz (Bayern). Neben sehr offenen Beständen mit Arten der Silbergras-Rasen gibt es Flechten-Kiefernwälder fast ohne Gefäßpflanzen sowie solche mit Vaccinium-Arten, die zu den weiter verbreiteten Beerstrauch-Kiefernwäldern und -forsten überleiten. Flechten-Kiefernwälder repräsentieren in Mitteleuropa einen Biodiversitätshotspot für bodenbewohnende Strauchflechten, insbesondere Rentierflechten und andere Vertreter der Gattung Cladonia. Außerdem beherbergen sie eine Vielzahl von anderen Flechten, Moosen und Großpilzen und sind auch für den zoologischen Artenschutz von Bedeutung. Sie stellen einen FFH-Lebensraumtyp gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie der EU (Code 91T0) dar. Flechten-Kiefernwälder stehen am Anfang einer natürlichen Waldentwicklung auf Rohböden über Sand oder Quarzgestein und wurden in der Neuzeit durch Streuentnahme und Plaggenhieb, teilweise auch Waldweide, auf entsprechenden Standorten stark gefördert. Ihre größte Ausdehnung hatten sie vermutlich im 19. und frühen 20. Jahr-hundert. Nach Aufgabe dieser Nutzungsformen sind sie gegenwärtig vor allem durch Eutrophierung infolge von Stickstoffeinträgen stark gefährdet. Durch das erhöhte Nährstoffangebot breiten sich konkurrenzkräftige Laubmoose, teils auch Zwergsträucher und die Draht-Schmiele aus, die die typi-schen Flechten und niedrigwüchsigen Moose verdrängen. Allein seit den 1990er Jahren sind in Deutschland ca. 90 % der Bestände verloren gegangen. Weitere Gefährdungsursachen sind Flächenver-brauch durch Sand- und Gesteinsabbau oder Bebauung, aktiver Waldumbau, fehlende Morphodynamik und in den letzten Jahren auch Hitze- und Dürreperioden. Die gegenwärtig noch vorhandenen, teilweise kurz vor der Extinktion stehenden Restbestände müssen nicht nur vor direkter Zerstörung geschützt, sondern – ähnlich wie bei vielen Offenlandhabitaten – durch aktive Schutzmaßnahmen erhalten werden. In degenerierten Beständen muss zunächst eine Entfernung der Streu- und Humusauflage und anschließend eine Beimpfung der Rohböden mit Flechten-Bruchstücken erfolgen. Erste Ergebnisse aus solchen Renaturierungsprojekten aus der niedersächsischen Elbtalaue und aus Mittelfranken werden hier präsentiert. Wir möchten lokale und regionale Akteure im Naturschutz ermuntern, entsprechend aktiv zu werden. In Sandgruben und Steinbrüchen können bei einem Verzicht auf Rekultivierungen Flechten-Kiefernwälder auch neu entstehen.
One of the most endangered plant communities in Germany, and one that is on the verge of extinction, is the lichen pine forest (Cladino-Pinetum sylvestris, syn. Cladonio-Pinetum sylvestris). For this reason, it has been selected by the Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft as the “Plant Community of the Year 2025”. Lichen pine forests are unproductive, sparse and understorey-poor coniferous forest ecosystems, mainly in the planar and colline altitudinal zone. The soils are extremely nutrient-poor and acidic, usually very dry with a poorly developed humus layer. Lichen pine forests occur on outwash plains, moraines, dunes and valley sands, but also in mountainous areas with granite, quartzite or sandstone as parent rock. In Germany, this forest type is currently found only in small areas, mainly in sub-continental regions. Lichen pine forests occur mainly in the northeastern German inland lowlands from the Elbe valley in Lower Saxony eastward (Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony-Anhalt, Brandenburg) as well as in Middle Franconia and Upper Palatinate (Bavaria). In addi-tion to open woodlands with species of grey hair-grass swards (Corynephorion), there are lichen pine forests with almost no vascular plants and others with Vaccinium species, transitioning to the more widespread blueberry pine forests. Lichen pine forests represent a biodiversity hotspot in Central Europe for ground-dwelling fruticose lichens, especially reindeer lichens and other members of the genus Cladonia. They also host a variety of other lichens, bryophytes and macrofungi, and are impor-tant for faunal biodiversity. They represent an Annex I habitat type under the EU Habitats Directive (code 91T0). Lichen pine forests are at the beginning of natural forest development on immature soils on sand or quartz-rich rocks and have been strongly promoted by litter-raking and sod-cutting, and sometimes by grazing. They probably reached their greatest extent in the 19th and early 20th centuries. After the abandonment of the historical forest use, current stands are highly endangered, mainly by eutrophication due to natural succession and airborne nitrogen loads. Since the 1990s lichen pine forests in Germany have lost about 90 % of their former area. With an increased nutrient availability, com-petitive pleurocarpous mosses, sometimes dwarf shrubs and the wavy hair-grass, spread and displace the typical lichens and small-growing bryophytes. Other threats include land use (sand and stone mining, building areas), active forest conversion, a lack of morphodynamics and, in recent years, prolonged periods of heat and drought. Existing stands, some of which on the verge of extinction, must not only be protected from direct destruction, but also require active protection measures, similar to many open-land habitats. The restoration of lichen pine forests is only possible by removing the litter (together with the humus layer) and subsequently inoculating the raw soil with lichen fragments. First results from restoration projects in the Elbe valley of Lower Saxony and in Middle Franconia are presented. With these, we would like to encourage local and regional actors and conservationists to take appropriate action. In sand pits and quarries, refraining from recultivation measures can promote the formation of new lichen pine forests.
Siehe DOISiehe Institutional Repository DORA